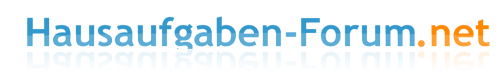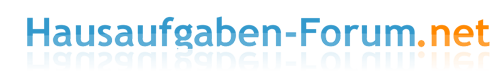Als Textform:
1. Umschreiben Sie die folgenden Begriffe:
a) Säure ist eine Wasserstoffverbindung
b) Hydroxid ist eine Verbindung, bei der ein (oder mehrere) Metallionen mit einem (oder mehreren) Hydroxidionen verbunden ist.
2. Ergänzen Sie den folgenden Text:
Bestimmte (also nicht alle) Säuren kann man aus Nichtmetalloxid und Wasser herstellen.
Laugen entstehen, wenn man Metalloxide zu Wasser gibt.
Sie (die Laugen, nicht die Säuren) färben Phenophthalein rotviolett und Lackmus blau.
Beim Eindampfen der Laugen bilden sich weiße Rückstände, die als Metallhydroxide bezeichnet werden.
3. Ergänzen Sie die folgenden Gleichungen und benennen Sie die Stoffe 1 bis 4.
Tragen Sie gegebenfalls Vorzahlen ein.
Zahlen als tiefgestellt betrachten außer die in Klammern.
a) SO2 + H2O = H2SO3
Benennung von (1) schweflige Säure
b) P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4 (2)
Benennung von (2) Phosphorsäure
c) CaO + H2O = Ca(OH)2 (3)
Benennung von (3) Calciumhydroxid
4. Silberchlorid (AgCl) wird zu Wasser gegeben.
(Hinweis: Ag = einwertig, Cl = einwertig)
a) Schreiben Sie die Dissoziationsgleichung auf.
AgCl --> Ag^+ + Cl^-
Diese Reaktion läuft aber kaum ab, da AgCl sehr schwer löslich ist.
Dies ist meiner Meinung nach ein sehr schlechtes Beispiel für eine Dissoziation.
b) Erklären Sie die Begriffe "Ion", "Kation", "Elektrolytlösung".
Ion ist ein elektrisch positiv oder negativ geladenes Atom oder Molekülrest.
Kation ist ein positiv geladenes Ion.
Eine Elektrolytlösung ist eine Lösung, die eine oder mehrere gelöste Ionenverbindungen enthält.
5. Die Silberchloridlösung wird in ein U-Rohr gefüllt und mit Hilfe des Stromes zersetzt.
a) Welche Stoffe entstehen an den Elektroden?
An der Kathode würde Silber und an der Anode Chlor entstehen.
Ein ausgesprochen schlechtes Beispiel, denn die Silberchloridlösung gibt es aufgrund der Schwerlöslichkeit von AgCl nicht.
b) Welcher Vorgang läuft an der Kathode, welcher an der Anode ab?
Kathode: Silberionen werden Silber reduziert. Ag^+ + e^- --> Ag
Anode: Chloridionen werden oxidiert. Cl^- --> ^Cl + e^-
c) Formulieren Sie eine Gesamtgleichung für die elektrolytische Zersetzung von AgCl
2 AgCl -> 2 Ag + Cl2