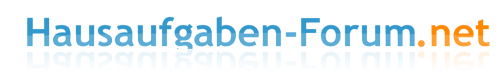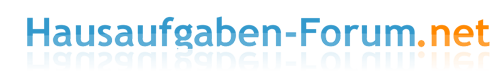Zu 1)
Im Prinzip hast Du ja alles zu dieser Aufgabe richtig gesagt, so dass ich Dein Problem nicht sehe.
Also noch einmal zussammengefasst:
Wenn ein Stoff Protonen abgibt, dann ist es eine Säure. Jede Wasserstoffverbindung kann mehr oder weniger gut ein Proton abgeben. Je nachdem handelt es sich dann um eine starke Säure (das Proton wird sehr leicht abgegeben) oder um eine äußerst schwache Säure (das Proton wird fast gar nicht abgegeben).
Das Proton wird nur abgegeben, wenn ein Stoff da ist, der in der Regel das Proton aufnehmen kann. Diesen Stoff bezeichnet man als Base. Die wichtigste Base im Chemieunterricht, die Protonen aufnehmen soll, ist das Wasser.
Es kommt also, wenn ich die Säure ganz allgemein mit HR bezeichne zu der folgenden Reaktion (sie heißt Protolyse):
HR + H2O --> H3O+ + R-
Zu 2)
Die Reaktionsgleichung könnte man ganz allgemein in der folgenden Form formulieren:
Zn + 2 HCl --> ZnCl2 + H2
Nun will man aber genauer wissen, was bei dieser Reaktion passiert. Da hilft einem die Kenntnis der Oxidationszahl (ich hoffe, Du kannst damit umgehen).
Zn hat auf der Eduktseite OZ = 0 (alle Elemente haben im elementaren Zustand OZ = 0)
Auf der Produktseite hat Zn die Oxidationszahl OZ = +II. Wenn sich die OZ erhöht, dann wird ein Stoff oxidiert und das heißt wiederum, er gibt Elektronen ab.
Der Wasserstoff im HCl hat OZ = -I und im entstehenden Wasserstoff OZ = 0 (Gasmoleküle, die aus den gleichen Atomen bestehen haben auch OZ = 0). Wenn sich die OZ erniedrigt, dann wird dieser Stoff reduziert.
Das waren die Gedanken vorab für die geforderten Teilgleichungen. Diese ergeben sich wie folgt:
Oxidation: Zn --> Zn2+ + 2 e-
Reduktion: 2 H + 2 e- --> H2
So wie ich es Dir oben bei der Protolyse gesagt habe, dass ein Proton nur dann abgegeben wird, wenn ein anderer Stoff dieses Proton aufnimmt, so ist es auch hier.
Ein Elektron wird nur abgegeben, wenn ein anderer Stoff vorhanden ist, der dieses Elektron aufnimmt.
Man kann also beide Gleichungen von oben zusammenfassen zu einer sogenannten Redoxgleichung. In dieser werden die Elektronen herausgekürzt, also nicht geschrieben.
Redoxgleichung: Zn + 2H --> Zn2+ + H2
Noch eine Anmerkung: Den Wasserstoff in Reaktionsgleichung musst Du immer, wenn er als Gas vorliegt, als H2 schreiben. In der Verbindung HCl liegt er aber nicht als Wasserstoffmolekül vor und deshalb schreibt man hier H.