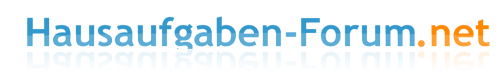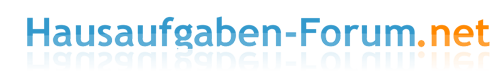Diese Woche schreibe ich in Deutsch eine Klausur über "Tauben im Gras", in der wir eine Szene hinsichtliche der verwendeten erzählerischen Mittel analysieren sollen. Als Vorbereitung habe ich einen Abschnitt aus dem Buch analysiert. Allerdings bin ich mir mit den Fachbegriffen, gerade was das Erkennen der verschiedenen Darbietungsformen angeht, sehr unsicher. Folgenden Abschnitt habe sich analysiert: S. 66 bis 67
>Das Beste für Carla.< Washington war im großen Verkaufsraum des Central Exchange, Er ging zu dem Damenartikeln hinüber. Was wollte er? >Das Beste für Carla.< Die deutschen Verkäuferinnen waren freundlich. Zwei Frauen wählten Nachthemden. Es waren Frauen von Offizieren, und die Nachthemden waren lange Gewänder aus rosa und schilfgrünem Crepe de Chine. Die Frauen würden wie üppige Göttinnen im Bett liegen. Die Verkäuferin ließ die Frauen bei den Hemden allein. Sie wandte sich Washington zu und lächelte. Was wollte er? Ein Sausen war in der Luft. Ihm war noch immer, als habe er die Telefonmuschel am Ohr und höre Wörter, die über den Ozean gesprochen wurden. Durch technischen Zauber war er zu Hause in Baton Rouge. Durch welchen Zauber stand er im Central Exchange einer deutschen Stadt? Was wollte er? Es war gut, und es war schändlich: er wollte heiraten. Wem wollte er Kummer bereiten, wen unglücklich machen? War jeder Schritt gefährlich? Auch hier? In Baton Rouge hätten sie ihn totgeschlagen. Die Verkäuferin dachte >er ist schüchtern, diese Riesen sind immer schüchtern, sie suchen Wäsche für ihre Freundinnen und trauen sich nicht zu sagen was sie wollen.< Sie legte ihm vor, was sie in diesem Fall für passend hielt, Höschen und Hemdchen, leichte zarte Schleier, die richtige Nuttenwäsche, >das richtige für die Fräuleins<, schattenfein, mehr zur Anreizung als zur Verhüllung. Die Verkäuferin trug dieselbe Wäsche. >Ich könnt’s ihm zeigen<, dachte sie. Washington wollte die Wäsche nicht. Er sagte >>Kinderwäsche<<. Die Verkäuferin dachte >o weh, er ihr schon ein Kind gemacht>. - >Sie sollen gute Väter sein<, dachte sie, >aber ich möchte kein Kind von ihnen haben<. Er dachte, >man muss jetzt an die Kindersachen denken, man muss alles rechtzeitig besorgen, aber Carla müsste es aussuchen, sie wird wütend sein, wenn ich es aussuche und mitbringe<. - >>Nein. Doch kein Kinderwäsche<<, sagte er. Was wollte er? Er deutete unentschlossen auf die leichten Gewebe der erotischen Verführung. Die Offiziersfrauen hatten ihre Nachthemden gefunden und blickten Washington böse an. Sie riefen nach der Verkäuferin. >Er lässt sie mit dem Kind sitzen<, dachte die Verkäuferin, >er hat schon eine neue Braut, der schenkt er die Reizwäsche, so sind sie, Schwarze wie Weiße.< Sie ließ Washington stehen und schrieb den Verkaufszettel für die Offiziersfrauen aus. Washington legte seine große braune Hand auf ein Stück gelber Seide. Die Seide verschwand wie ein gefangener Schmetterling unter seiner Hand.
Hier ist ein Teil meiner Analyse:
Wär echt super, wenn ihr mir ne Rückmeldung geben könntet, ob ich die Begriffe dem Text einigermaßen vernünftig zuordnen konnte ![]()
Nachfolgend wird der Romanauszug im Hinblick auf die Verwendung erzählerischer Mittel analysiert. Auf die folgenden Aspekte wird näher eingegangen: die Erzählform, der Erzählstil, der Erzählerstandort, die Erzählperspektive, das Erzählverhalten, die Erzählhaltung und die Darbietungsformen.
Zunächst gehe ich auf die Erzählform ein. Im vorliegenden Auszug ist eindeutig die Er-/Sie-Form als vorherrschende Erzählform identifizierbar. Dies ist schon zu Beginn des Auszugs in der rhetorischen Frage „Was wollte er?“ (Z. 3)exemplarisch erkennbar, aber auch durch weitere Personalpronomen wie „sie“ (Z. 9). Durch die Verwendung dieser Erzählform bleibt der Erzähler außerhalb des Geschehens, erzählt nur von Figuren und bleibt selbst unsichtbar, da ihm keine Personalität zugeordnet werden kann. So fungiert er nur als Medium, kann aber wertend eingreifen.
Anschließend wird der Erzählstil charakterisiert. Der Erzählstil in „Tauben im Gras“ ist sehr satirisch. Auch die innere Monologform ist auffallend oft erkennbar. Zudem werden gezielt Montagetechniken angewandt, die Verbindungen scheinbar zusammenhangloser Handlungsstränge ermöglichen und einzelne Bilder und Sequenzen so aneinanderfügen, dass der Leser selbst gezwungen ist, einen Sinn dahinter zu entdecken. In vielen Szenen verdeutlicht die Montage ebenfalls die chaotische Situation im Nachkriegsdeutschland. Zusätzlich erschwert es die Figurenvielfalt und Multiperspektivität dem Leser, den Überblick zu behalten. Der Nachweis von Satire beinhaltet deren Definition als Spottdichtung, die mangelhafte Tugend oder gesellschaftliche Missstände anklagt, voraus. So tritt diese vor allem in sprachlichen-kontrastierenden Bildern wie dem „technischen Zauber“ (Z. 13) hervor, der durch die Gegenüberstellung beziehungsweise gar skurrile Gleichstellung des Fortschrittsglaubens mit dem konservativen Bild mittelalterlicher Magie Gesellschafts- und Fortschrittskritik darstellt, die sich in der folgenden Handlung konkretisiert: Der „Central Exchange“ (Z. 15) kontrastiert hier seinen Standort in einer „deutschen [Nachkriegs-]Stadt“ (Z.3). Hierbei lässt sich die Antithese „Es war gut, und es war schändlich“(Z. 15 f.) auch auf den technischen Fortschritt übertragen, der neben seinen komfortablen Vorteilen auch technische Risiken als Schattenseite beinhaltet. Hier übernimmt die Satire eine kritische, aber auch unterhaltende Funktion ein. Jedoch stellt diese sich auch in der übertriebenen Darstellung von gesellschaftlichen Klischees dar: „diese Riesen sind immer schüchtern“ (Z. 20). Auch das sprachlich-affirmative Symbol der „richtige[n] Nuttenwäsche“ (Z.24) stellt dies beispielhaft dar, da die Verkäuferin Vorurteile verfolgt, die sie von maximal Pigmentierten hat, indem sie überlegt, dass sie als Liebhaber einen guten Ruft haben und erwägt, ihm ihre Unterwäsche vorzuführen. Zuvor hat die Verkäuferin jedoch noch den Gedanken verfolgt, dass dieselbe Wäsche nuttenhaft sei. Dass sie sich einerseits erhaben fühlt, über den Prostituierten zu stehen, weil diese mit maximal Pigmentierten schlafen müssen, um Geld zu verdienen, erscheint dem Leser als absurd.
Nun wird der Erzählerstandort untersucht. Der Erzählstandort ist nahe bei den Figuren gewählt, da der Erzähler der Figurenkonstellation nahe steht. Er scheint jedoch auch mit dieser genauer vertraut zu sein und behält insgesamt den räumlichen und zeitlichen Überblick über das Geschehen, sodass der Erzählerstandort als „olympischer Erzählerstandort“ einzustufen ist.
Bezüglich der Erzählperspektive gestalten sich deren Wechsel im vorliegenden Auszug fließend: Zu Beginn werden die Gedanken Washingtons aus der Innensicht beschrieben (vgl. Z. 1 bis 4). Danach wechselt die Perspektive bei der Beschreibung der Geschäftsräume, Verkäuferinnen und Kundinnen in die Außenperspektive (vgl. Z. 4 bis 6) und taucht anschließend wieder durch das Mittel der indirekten Rede mit Washingtons Gedankenwelt in die Innenperspektive ein (vgl. Z. 7 bis 8 ). Kurz wird die Handlung der Verkäuferin aus der Außenperspektive dargestellt (vgl. Z. 9 bis 10 ) bevor zur Innensicht Washingtons zurückgewechselt wird (vgl. Z. 10 bis 19 ).Später wechselt die Perspektive auch zur Innensicht der Verkäuferin und ermöglicht einen Einblick in deren Denkweise (vgl. Z. 19 bis 27), wechselt jedoch danach wieder zur Innensicht Washingtons zurück (vgl. Z. 27 bis 34). Danach geht die Erzählung bei der Beschreibung von Washingtons Handeln und den „Offiziersfrauen“ (Z. 37) jedoch wieder in die Außenperspektive über (vgl. Z. 34 bis 39) und wechselt zurück zur Innensicht der Verkäuferin (vgl. Z. 39 bis 43). Zuletzt wird Washingtons Handeln bis zum Schluss wieder aus der Außensicht beschrieben (vgl. Z.43 bis 45). Die vielen verschiedenen Perspektiven und Perspektivwechsel erzeugen Distanz, sodass die Handlung im Vordergrund steht.
Das Erzählverhalten lässt sich als auktorial beschreiben, da eine eigene Sichtweise des Erzählers erkennbar ist und sich durchaus ins Bewusstsein des Lesers einbringt, auch wenn die Perspektiven der handelnden Personen miteinbezogen werden. So sind dem Erzähler beispielweise nicht nur die Gedanken Washingtons bekannt, sondern auch die der Verkäuferin. Zudem macht sich der Erzähler durch wertende Beschreibungen wie „große braune Hand“ (Z. 43 f.) und den Vergleich „wie ein gefangener Schmetterling“ (Z. 44 f.) bemerkbar. Auch die Er-Erzählform und der „olympische Erzählstandort“ harmonieren mit diesem Erzählverhalten. Auch kommentiert der Erzähler das Geschehen allwissend „In Baton Rouge hätten sie ihn totgeschlagen“ (Z. 18 ).
Aus dem Auszug geht eine kritische wie ironische, aber auch affirmative Erzählhaltung hervor, die sich nicht nur in der bereits nachgewiesenen Satireform äußert, sondern auch durch kritische Wortlaute wie „Offiziersfrauen“ (Z. 37), die Assoziationen an einen Escort-Service zur Unterhaltung amerikanischer Offiziere wecken und die wirtschaftliche wie poltisch-kulturelle Abhängigkeit von Amerika kritisiert. Affirmativ zur Haltung der Verkäuferin wirkt zum Beispiel die Wortwahl des „Riesen“ (Z. 20), der die rassistische Grundeinstellung der Verkäuferin wie einem Großteil der deutschen Bevölkerung verstärkt.
Die Darbietungsform des Textes ist größtenteils die erlebte Rede, durch die vordergründig die Figuren dargestellt werden. Jedoch wechselt die Darbietungsform im vorliegenden Romanauszug öfters. So wie in Zeile 7 indirekte Rede aus Perspektive Washingtons in die erlebte Rede eingeschoben. Danach erfolgt ein Erzählerbericht (vgl. Z. 8 bis 11). Anschließend wechselt die Darbietungsform wieder zur erlebten Rede. In Zeile 18 wird ein Erzählerkommentar eingeschoben „In Baton Rouge hätten sie ihn totgeschlagen“ (Z. 18 ). Erst zum Schluss geht die erlebte Rede wieder in einen Erzählerbericht über (vgl. 43 bis 45).