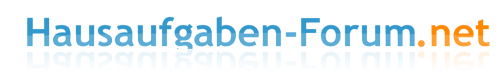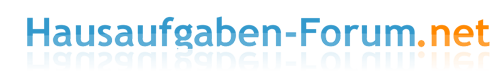Hallo zusammen! Ich habe hier eine Aufgabe zu Gedicht von Bertolt Brecht: Über das Frühjahr. Es ist nur eine Teilaufgabe.
a) Beschreiben Sie den Inhalt und Aufbau des folgenden Gedichts.
Über das Frühjahr
Lange bevor
Wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak
Gab es in jedem Jahr
Die Zeit der unaufhaltsam und heftig grünenden Bäume.
Wir alle erinnern uns
Verlängerter Tage
Helleren Himmels
Änderung der Luft
Des gewiß kommenden Frühjahrs.
Noch lesen wir in Büchern
Von dieser gefeierten Jahreszeit
Und doch sind schon lange
Nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten
Die berühmten Schwärme der Vögel.
Am ehesten noch sitzend in Eisenbahnen
Fällt dem Volk das Frühjahr auf.
Die Ebenen zeigen es
In aller Deutlichkeit.
In großer Höhe freilich
Scheinen Stürme zu gehen:
Sie berühren nur mehr
Unsere Antennen.
Folgendes habe ich erarbeitet:
a) In seinem Stadtgedicht „Über das Frühjahr“ aus dem Jahr 1928 macht der Dichter Bertolt Brecht auf die Industrialisierung des Landes und die Ausbeutung der Natur sowie die Entfremdung des Menschen von der Natur in der Zeit der Weimarer Republik zum Thema. Es war die Zeit der nach dem verlorenen ersten Weltkrieg und Aufstieg Deutschlands zu einer Industriemacht.
Bei dem Gedicht handelt es sich um eine einzige Strophe, die aus 22 reimlosen Versen zusammengesetzt ist und weist kein Bestimmtes Metrum auf. Die meisten Versen sind kurz gehalten, bis auf die Versen 2,4 und 13. Es gibt insgesamt 6 Enjambements die unterschiedliche Kadenzen aufweisen. Der Dichter wollte den Sinnzusammenhang über die Versgrenze weiterführen, die Monotonie des Versmaßes, der sonst im Zeilenstil Satz und Vers vereint, wird durchbrochen. Das Enjambement in der Zeile 1 – 4 weisen Kadenzen in der Reihenfolge männlich, weiblich, männlich weiblich auf, in der Zeile 5 – 9 sind es überwiegend weibliche Kadenzen, außer in der Zeile 8, die ist männlich. Das Enjambement in der Zeilen 10 – 14 enthält überwiegend weibliche Kadenzen, außer in der Zeile 11. Im nächsten Enjambement, Zeile 15 u. 16, sind es weibliche Kadenzen und in der Zeilen 17 u. 18 sind es eine weiblich und eine männliche. Im letzten Enjambement, Zeile 19 – 22, sind es nur weibliche. Die Zweite Verse weist als einzige eine Zäsur auf.
Beim genauen Lesen fällt auf, dass die Versen 1 – 9 die Erinnerung an das Frühjahr aus der Vergangenheit beschreibt und ab Zeile 10 – 22 wird die Gegenwart, zur Zeit des Dichters, beschrieben. Der Dichter wählte als Lyrisches Genre das Erzählgedicht, da er mit diesem Gedicht auf das Alltägliche verweisen möchte, ohne dabei dramatisch zu klingen. Zur Sprachhaltung wurde die Elegie gewählt, um seine Trauer über die zerstörerische Ausbeutung der Natur und seiner Sehnsucht nach ihr zu verleihen. Das gesamte Gedicht wurde im lyrischen ich geschrieben. Das erkennt man an den Wörtern „Wir“ (Zeile 2,5,10), „unsere“ (Z. 13) und „Unsere“ (Z.22). Damit stellt der Verfasser seinen Bezug zum erzählten, dass er mitten drin in dieser Zeit sich aufhält.
Kann jemand, der sich gut auskennt, sich meine Lösung anschauen und mir sagen was noch fehlt, was und wie verbessert werden kann o. soll usw.
Danke im Voraus!