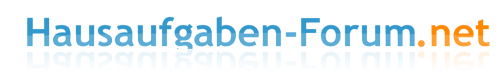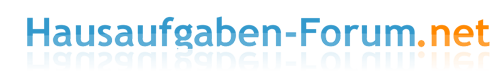Hallo, ich habe das Gedicht "Menschliches Elende" von Andreas Gryphius analysiert.
Was sind wir Menschen doch! ein Wonhauß grimmer Schmertzen?
Ein Baal des falschen Glücks / ein Irrliecht dieser Zeit
Ein Schauplatz aller Angst / unnd Widerwertigkeit
Ein bald verschmelzter Schnee / und abgebrante Kertzen /
Diß Leben fleucht darvon wie ein Geschwätz und Schertzen.
Die vor uns abgelegt des schwachen Leibes kleid /
Und in das Todten Buch der grossen Sterbligkeit
Längst eingeschrieben sind; find uns auss Sinn' und Hertzen:
Gleich wie ein eitel Traum leicht auss der acht hinfält /
Und wie ein Strom verfleust / den keine Macht auffhelt;
So muss auch unser Nahm / Lob / Ehr und Ruhm verschwinden.
Was itzund Athem holt; fält unversehns dahin;
Was nach uns kompt / wird auch der Todt ins Grab hinzihn /
So werden wir verjagt gleich wie ein Rauch von Winden.
Interpretieren Sie das Gedicht von Andreas Gryphius (1618 - 1664).
Analyse:
Das Gedicht "Menschliches Elende" von Andreas Gryphius handelt von Vergänglichkeit, Schmerzen, Leid und Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens.
Es beginnt mit der Beschreibung der Vergänglichkeit und der Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens mithilfe vieler Metapher. Dann gibt der Sprecher dem Leser zu bedenken, dass alle Errungenschaften des Menschen mit ihm sterben und dass es sich noch nicht einmal lohnt, für seine Geliebten oder seine Familie zu leben, weil sie alle auch sterbliche Menschen sind.
Ganz zu Beginnn wird der Mensch einem "Wohnhauß grimmer Schmertzen" gleichgesetzt (V. 1), was dem menschlichen Körper zuschreibt, etwas zu sein, wo Schmerzen von Natur aus schon existieren. Damit beschreibt der Sprecher die körperliche Hülle eines Menschen als von Schmerzen und Leid gefüllt. Zusätzlich gibt er ihr die Bedeutung eines "Schauplatz[es] aller Angst / unnd Widerwertigkeit" (V. 3), um die Grausamkeit des menschlichen Daseins zu betonen. Die Vergänglichkeit des Menschenlebens wird durch den "bald verschmelzte[n] Schnee" und die "abgebrante[n] Kertzen" (V.4) und die Sinnlosigkeit durch dessen Vergleich mit einem "Geschwätz und Schertzen" (V. 5) dargestellt. Genauso wie es feststeht, dass der Schnee schmilzt (vgl. V. 4), sei jeder Mensch "in das Todten Buch der grossen Sterbligkeit Längst eingeschrieben" (V. 7f.). Damit will der Sprecher aus der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens den Schluss ziehen, dass es sinnlos ist, weil nach dem Tod "auch unser Nahm / Lob / Ehr und Ruhm verschwinden" (V. 11) wird. Aus der Sicht des Sprechers kann man im Leben also nichts leisten, das es sinnvoll machen würde, weil all unsere Errungenschaften auch irgendwann vergehen. Bei weiterer Verarbeitung dieses Gedanken, ist auch jeder Atemzug überflüssig, da man jeden Moment "unversehns dahin [fallen]" (V. 12) und sterben kann. Bei solch einem Ausgang ist dieser Atemzug kurz vor dem Tod völlig überflüssig und sinnlos gewesen, da er den Tod nicht vorbeugen konnte. Der Grund, für seine Geliebten zu leben, wird vom Sprecher auch gekontert, da früher oder später der Tod auch diese mit "ins Grab hinzihn" wird (V. 13). Somit gelangt der Sprecher ausgehend von der Grausamkeit, Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens am Ende zu der Schlussfolgerung, dass der Mensch - egal, was er tut oder erreicht - "verjagt [wird] gleich wie ein Rauch von Winden" (V. 14). (Habe ich hier die Spiegelstriche richtig angewendet?)
Hier handelt es sich um ein barockes Gedicht, da man es einerseits an der Lebenszeit von Andreas Gryphius (1618 - 1664) und andererseits an dem im Gedicht vorherrschenden Vanitas-Motiv erkennt. Dieses Motiv besagt, dass das Menschenleben hohl, vergänglich und sinnlos ist und ist in vielen Aussagen des Gedichts zu finden, wie im Vergleich des Menschen mit dem "Schauplatz aller Angst / unnd Widerwertigkeit" (V. 3) oder mit dem "bald verschmelzte[n] Schnee" (V. 4). Außerdem bezieht sich das Gedicht nicht nur auf eine individuelle Person sondern auf die ganze Rasse Mensch, genauso wie es im Barock immer geschehen ist. Belege dafür sind Aussagen wie "wir Menschen" (V. 1) oder "nach uns" (V. 13). Somit weisen die Zeit, das Motiv und der Bezug alle auf ein barock'sches Gedicht.
Hinzuzufügen bleibt nur noch, dass das Gedicht einen Alexandriner als Metrum hat, der Gedanken antithetisch kontrastiert, wie dies beispielweise in diesem Satz geschieht: "Was itzund Athem holt; fält unversehns dahin" (V. 12). (Habe ich den Doppelpunkt hier richtig angewendet? Ist das Zitieren eines ganzen Verses in diesem Zusammenhang legitim?) Damit beschreibt der Sprecher einen Menschen, der in dem einen Augenblick atmet und in dem anderen bereits tot ist, was die Wirkung drastisch erhöht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gedicht "Menschliches Elende" von Andreas Gryphius das menschliche Leben als vergänglich und daher als sinnlos beschreibt. Der Mensch könne seinem Leben noch nicht einmal einen Sinn geben, indem er etwas Großes leistet oder erringt, da auch dies irgendwann vergeht. Der Tod des Menschen sei schon immer festgelegt und man könne nichts daran ändern, weswegen jeder Atemzug völlig sinnlos sei.
Meiner Meinung nach hat der Autor dieses ziemlich depressiven Gedichts eine sehr verengte Sicht auf das Leben, da er sehr oberflächlich und materialistisch denkt. Natürlich wird die körperliche Hülle des Menschen und alles andere Manifeste dieser Welt irgendwann vergehen und sich wandeln. Deshalb sollte man sich nicht zu sehr darauf fokussieren, wenn man nicht so depressiv werden will wie der Sprecher des Gedichts. Um die Schönheit und das Gute des Lebens zu erfahren, muss man leben um des Lebens Willen!