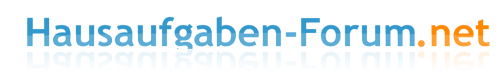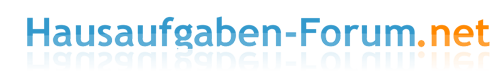Hallo,
mein Name ist Erhan Güzel und ich möchte euch fragen, wie ihr meinen Essay findet.
Hier ist er:
„Tod oder Freiheit“ (1)
„Die Räuber“ ( Friedrich Schiller )
Freiheit wird im allgemein als die Möglichkeit ohne Zwang zu handeln verstanden. Freiheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und die Voraussetzung für alle menschlichen Handel. Dabei wird zwischen Freiheiten unterschieden, denn nicht alle Freiheiten bedeuten das Gleiche. Es wird unterschieden zwischen den äusseren Freiheit, eine Erlösung vom äusseren Zwang, die von einer anderen Person kommt, und der innere Freiheit, der Souveränität. (2)
Das Thema „ Freiheit“ wird ständig in der Geschichte behandelt und ist häufig der Auslöser für Konflikte und Auseinandersetzungen, die letztendlich zu einer Selbstzerstörung der Familie Moor führt.
Für Karl Moor, der Räuberhauptmann und der Erbe des Grafen von Moor, hat eine unterschiedliche Vorstellung von der Freiheit. Schon von Anfang an lehnt sich Karl gegen die Gesellschaft und die handlungseinschränkenden Gesetze auf. Auf diese Weise verhindere man die freie Entwicklung des Menschen, was Karl im folgenden Satz erwähnt: „ Das Gesetz hat noch keinen grosse Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus.“ ( S.28 Z.22). Er wendet sich klar gegen den Absolutismus. Nach dem Brief von seinem Bruder Franz, in dem berichtet wird, dass er enterbt wurden sei, entschied er sich Räuberhauptmann zu werden. Diese Handlung verstärkt seinen Drang nach der Freiheit, dass er sozusagen nur noch zwischen einem gesetzlosen Leben im Wald oder dem Tod entscheiden konnte. „ Itzt sind wir frei - Kameraden! Ich fühle eine Armee in meiner Faust - Tod oder Freiheit! […]“ ( S.91 Z.23 ).
Die Räuberbande kämpft mit allen Mitteln für ihre Freiheit. Doch die Taten der Bande dienen nicht nur den Freiheitsidealen von Karl, sondern auch den Mitgliedern der Bande. Das stellte Karl unter Beweis, in dem er eine ganze Stadt in die Luft jagte um seinen Freund Roller von dem Galgen zu retten (S. 78). Am Schluss des Dramas zeigt sogar das seine Freiheit wichtiger ist als seine Verlobte Amalia, die er als Preis für seine Freiheit tötet (S. 165 Z.24-29).
Für die Räuber, die in der Bande von Karl sind, bedeutet die Freiheit ein gesetzloses Leben, was ihnen ein Grund gibt zu leben und das Leben zu geniessen. Dies wird im Lied der Räuber verdeutlicht: „ Stehlen, morden, huren, balgen/Heisst bei uns nur die Zeit zerstreun, /Morgen hangen wir am Galgen, /Drum lasst uns heute lustig sein.-/ Ein freies Leben führen wir, […]“ In genaueren Betrachtung der Räuber erkennt man, dass es das freie Leben ist , was sie sich vorgestellt haben. Sie werden überall gesucht. In anderen Worten: Die fliehen die ganze Zeit vor dem Tod, auch wenn sie tun und lassen was sie wollen. Ein zweiter Widerspruch für ihre Freiheit ist, dass sie unter dem Befehl von ihrem Hauptmann Karl stehen. Das verringert ihre Handlungsfähigkeit und somit ihre Freiheit. Doch sie nehmen es in Kauf, was sie in der folgenden Textstelle verdeutlicht wird: „ Wir schwören dir Treu und Gehorsam bis in den Tod!“
Für Franz Moor, dem jüngeren Bruder von Karl Moor, hat die Freiheit noch einmal eine komplett andere Bedeutung für die Freiheit. Das Bedürfnis der Freiheit des Herrschens bringt ihn dazu seinen grösseren Bruder, den eigentlichen Thronfolger seines Vaters, durch einen Betrug zu enterben. Dies sagt er in diesem Satz: „ Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebeswürdigkeit gebricht ab.“ In diesem Satz zeigt, dass er durch seinen Vater und Bruder verhindert wird seine Freiheit zu leben. Indirekt beansprucht er mit der Freiheit des Herrschens auch die Freiheit über die Menschen zu bestimmen. Das verdeutlicht er als er Herrmann für seine eigene Zwecke verwendete. Diese Freiheiten sind Franz lebenswichtig. Im fünften Akt begeht er sogar Selbstmord als sein Besitzt, seine Freiheit, von den Räubern bedroht fühlte.
Ich denke, dass der junge Schiller, als einer der berühmtesten Stürmer und Dränger, ein Verteidiger der Freiheitsidee. Mit dem weltbekannten Drama „Die Räuber“ kann man die Einstellung von Schiller gegenüber der Freiheit erkennen. Seine Freiheitsideale verkörpert, der Held des Lesers, Karl Moor, der sich gegen die einschränkende Gesetzte wiedersetzt und im Allgemeinen nach seinen Gefühlen handelt. Er vertritt sozusagen die Stürmer und Dränger. Doch die Freiheitsvorstellung von Karl beruht sich auf das aufklärerische Denken, dessen Ziel es ist den Herrscher zu stürzen um selber an die Macht zu kommen. Diese Einstellung wird von Schiller negativ interpretiert. Aus diesem Grund wird die auch von dem schlechten Charakter Franz verkörpert.
(1) „Die Räuber“ ( Friedrich Schiller ) – Suhrkamp BasisBibliothek S.91
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
---