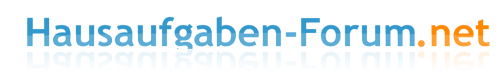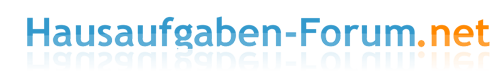hallo, wir haben hausaufgaben aufbekommen und es würd wirklich gern interessieren was ihr zu dieser Asuarbeitung der Hausaufgabe sagt. Ich sollte eine textgebundene Erörterung über eine Zeitungsartikel schreiben. Nur leider fehlr mir noch der Schluss. Wie macht man den ? Und wie findet ihr mein Interpretation ? Ich möcht nicht dass mir jemand hier den Aufsatz korrigiert, sonder nur ein paar Eindrücke. Was war schlecht, was gut?? An was muss ich noch arbeiten.
so hier der Aufsatz:
Im Artikel „ Im Kaufrausch“ warnt der Verfasser, dass der Konsumrausch der Deutschen schnell zu einem Konsumzwang ausarten kann. Die zentrale These des Verfassers lautet, dass man mit Konsumrausch schnell kaufsüchtig werden kann.
Als erstes Argument führt der Verfasser den Anstieg der regelmäßigen Kinderarbeit an. Das ist aber nicht so schlimm, wenn die Arbeit zur Abarbeitung der Schulden gemacht wird. Der Verfasser untermauert seine These durch die Aussage, Jugendliche würden auch stehlen, weil sie sich die Sachen nicht leisten können. Außerdem wachsen die Kinder mit Schulden auf. Papa hat Schulden, Mama hat Schulden, für die Kinder ist das was völlig normales. Viele Erwachsene wollen sich immer leisten. Klar, dass sich da Überstunden ergeben. Gekauft wird als Ersatzbefriedigung, aus purer Langeweile oder Einsamkeit. Doch wie schnell kann aus diesem Kaufrausch dann Konsumzwang werden. Besonders die Jungendlichen sind davon betroffen. Jeder will ja schließlich am großen Erlebniskonsum teilhaben. Und wenn man nichts kauft, wird man schnell zum Außenseiter. Als Lösung zu diesem Problem nennt der Verfasser den gelegentlichen, wohl dosierten Verzicht. Nur durch diesen sei es möglich, den Kaufzwang aufzuweichen. Auch nur mit viel Gefühl kann man die automatisierten Konsumgewohnheiten entkrampfen.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich weiß der Verfasser zu überzeugen. Der Verfasser stützt seine These durch Belegung von Fakten und Langzeitstudien. Das gibt dem Leser das Gefühl, dass das was im Text steht, beweisbar ist. Gerade durch die Fakten. Der Text hat nur eine rhetorische Frage „ Und die Lösung aus dem Dilemma?“. Diese bezieht sich auf die zentrale These des Verfassers. Klar, dass der Leser dann denkt, ja weniger kaufen, dann hätte man auch keine Schulden. Doch wie der Leser aus dem Text erfährt, ist es doch nicht ganz so einfach, sich vom Kaufzwang loszureißen. Ich glaube auch, dass es der Aufmerksamkeit des Lesers dienen könnte. Auch mit Anaphern wie „ Kaufen als Ersatzbefriedigung, kaufen aus purer Langeweile oder Einsamkeit…“ versucht der Verfasser den Leser zu gewinnen. Diese Anapher dient dazu, das wiederholte Wort „Kaufen“ als besonders bedeutsam hervorzuheben, weil es in diesem Text genau um dieses eine Wort geht.
Der Verfasser überzeugt nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich. So nennt der Verfasser Die Folge des Konsumzwanges, dass Jugendliche sich nicht mehr viel leisten können und deshalb anfangen zu stehlen. Für dieses Argument sprechen allein die Statistiken, dass die Jugendkriminalität in den letzten Jahren zugenommen hat, was man vielleicht auf den Anstieg des Konsums zurückzuführen und damit in Verbindung gebrachten Argumentes. Als nächstes Argument bringt der den Anstieg der Kinderarbeit. Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, aber Statistiken haben gezeigt, das immer mehr Jugendliche ihre Schulden damit abtragen anstatt ihr eigenes Geld dazu zu verdienen. Dadurch verlieren sie ihre Freizeit und werden viel zu früh erwerbstätig. Dies kann auch den Eintritt in die Armut bedeuten. Damit verderben sich die Jugendlichen ihr Leben wenn sie zu viel Schulden haben. Der Ausstieg sei nach der Auffassung des Verfassers machbar. aBer nicht von einem Moment auf den anderen . Dies ein nur durch gelegentlichen, wohl dosierten Verzicht machbar. In diesem Argument stimme ich dem Verfasser voll zu.
so und hier noch der originalartikel als anhang:
Strahlende Mädchen werben in TV-Spots für "junge" Konten. Mal schnell Geld abheben ist geil. Wenn denn genug Geld auf dem Konto ist. Die "Welt am Sonntag" berichtet über einen dramatischen Anstieg der regelmäßigen Kinderarbeit. Gegen Brötchen ausfahren vor der Schule zwecks Taschengeldaufbesserung ist im Prinzip nichts einzuwenden, kritisch wird es erst, wenn der "Verdienst" dazu dient, Schulden abzutragen. In einer Talkshow zum Thema "Ladendiebstahl" erntete eine jugendliche Teilnehmerin den Lacher des Abends, als sie auf die Frage, warum sie denn immer wieder stehlen würde, ganz erstaunt antwortete: "Ist doch klar, weil ich die Sachen haben will und sie mir nicht leisten kann."
In einer Langzeitstudie "Schöne neue Freizeitwelt?", die 15 Jahre lang das Freizeitverhalten der Deutschen beobachtet hat, stellt das renommierte Hamburger BAT-Freizeit-Forschungsinstituts fest, dass 74 Prozent der Deutschen West und 61 Prozent der Deutschen Ost einem regelrechten Konsumrausch unterliegen - Tendenz steigend. Jeder Zweite der unter 30 Jährigen möchte gern mehr arbeiten, möchte sein Einkommen mit dem einzigen Ziel erhöhen sich in der Freizeit mehr Kleidung, Sport- und Hobbyartikel leisten zu können. Jeder Dritte hat dabei aber das ungute Gefühl in der Freizeit zu viel Geld auszugeben. Papa hat Schulden, Mama hat Schulden, viele Jugendliche wachsen damit auf, dass Schulden machen doch zum Leben einfach dazugehört. "Mami, dann geh doch Geld holen", sagte kürzlich eine Achtjährige zu ihrer Mutter, als die ihr eine Tauschengeldaufbesserung mit der Begründung verweigerte: "Kind, so viel Geld haben wir nicht." Konsequenterweise ist es für mehr als die Hälfte der jüngeren Generation (14 bis 29 Jahre) kein Problem zuzugeben, dass sie weit über ihre Verhältnisse leben. Vom Ausgeben zum Verausgaben ist ja auch nur ein kleiner Schritt. Kaufen als Ersatzbefriedigung, kaufen aus purer Langeweile oder Einsamkeit ist gang und gäbe. Wäe leicht kann aus Konsumrausch dann Konsumzwang werden, aus Vergnügen , Verdruss. Professor Horst W. Opaschowski, Leiter des BAT-Instituts: " Besonders für Jugendliche wird es immer schwieriger, sich aus diesem Kreislauf des Konsums zu befreien. Denn selbst ein partieller Ausstieg aus den Konsumzwängen wird schnell als Außenseitertum gebrandmarkt. Was wiederum Isolation und Vereinzelung zur Folge haben kann." Jeder will schließlich mitmachen beim großen Erlebniskonsum. Reisen ,Sport, Medien ,Kultur werden wie Ware vermarktet. Aggressiv und unwiderstehlich. Und teuer. Opaschowski: "Viele Illusionen über das herrlich freie Freizeitleben zerplatzen jetzt wie Seifenblasen." Und die Lösung aus dem Dilemma? Eine neue Freizeitkultur muss her. Konsum und Kosten definiert. Gemeinschaftliches Erleben, Zeit für andere haben ohne gleich an Wettbewerb zu denken. Eine neue Konsumkultur muss her. Ein Lebensstil, in dem das Wort "Verzicht" nicht verpönt ist. Nur durch wohl dosierten, gelegentlichen Verzicht kann man den Kaufzwang entkrampfen, nur mit viel Gefühl kann man die automatisierten Konsumgewohnheiten aufweichen. Konsumieren mit schlechtem Gewissen ist out. Über die Verhältnisse leben ist megaout. In dagegen ist zu sagen: "Das kann ich mir leisten. Kaufen mit Sinn und Verstand macht auch Spaß.