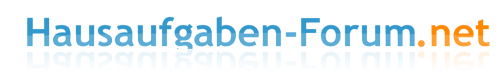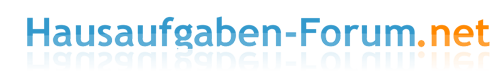Hallo ![]()
Ich schreibe am Dienstag eine Deutschklausur. Das ist eine Übung (nur zum ersten Teil der textgebunden Erörtuerung sprich der Analyse), ich würde mich über Feedback freuen. Ich beziehe mich auf folgenden Text:http://www.faz.net/aktuell/techni…au-1758040.html
Der vorliegende Text ist ein Artikel von Urs Gasser und trägt den Titel 'Surfen macht schlau'. Erschienen ist er im Buch 'Generation Internet', das 2008 vom Hanser Verlag publiziert wurde. Zentrales Thema sind die Auswirkungen des Internets auf die sogenannten 'digital natives', also jene Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Der Autor vertritt die These, dass ein Großteil der allseits bekannten Internetmythen nicht stimmen, sondern bloße Pauschalisierungen sind.
Die große Anzahl an falschen Internetmythen erklärt sich Autor mit der Unkenntnis der 'digital immigrants', jener Generation die das Internet erst im Laufe ihres Lebens kennengelernt haben, über die Netzwelt. Dies sei fatal, da deren Vorurteile eine unvoreingenommene Diskussion über digitale Medien verkompliziert.
Einer der bekanntesten Mythen sei, dass die Gefahr für Kinder im Internet auf Pädophile zu stoßen, erheblich sei. Vermutlich in einem Versuch, die Gegenposition miteinzubeziehen, gibt Gasser zu, dass Berichte aus den USA eine hohe Anzahl an Sexualstraftätern im Internet bestätigen, argumentiert anschließend jedoch, dass es keinen empirischen Nachweis gebe, dass die Gefahr im Internet höher ist als im richtigen Leben. Dieses induktive Argument als einzige Stütze seiner These ist unzureichend, da man das Argument ebenso gut für die Gegenposition verwenden könnt( Es gibt keinen Beweis, dass die Gefahr im Internet geringer ist).
Des Weiteren wissen Jugendliche entgegen aller Annahmen ihre Privatsphäre im Internet zu schützen. Wenngleich ein Blick auf Internetseiten, wie der Autor sich eingesteht, anderes vermuten ließe, belägen Studien einen sensiblen Umgang der Jugendlichen mit persönlichen Information. Neben diesem induktiven Argument zieht der Autor außerdem Interviews mit Jugendlichen heran, welche hervorbrächten, dass 'digital natives' über sogenannte 'Privatsphäre-Einstellungen' selbst festlägen, wie und mit wem sie ihre persönlichen Daten teilen. Außerdem würde gerade der regelmäßige Umgang und die Erfahrung mit dem Internet eine Sensibilisierung der Jugendlichen für private Informationen fördern. Da alle seine Argumente induktiver Art sind, deren Gültigkeit stark umstritten ist, ist das Urteil zu fassen, dass seine Argumentation auch bezüglich dieser These eher schwach ist.
Der nächste Mythos, den Gassler aufzudecken versucht, ist jener, dass Jugendlichen keinen Respekt vor dem Urheberrecht hätten. Zum einen sei die Frage, worin überhaupt eine Urheberrechtsverletzung bestehe, kompliziert und nicht nur für Jugendliche unklar. Davon abgesehen hätten Befragungen ergeben, dass Jugendliche in der Tat positiv zum Schutz des Urheberrechts eingestellt sind. Diese Argumentation ist ebenfalls nicht die Fundierteste: Sein erstes Argument beruht auf einem logischen Fehlschluss: Wenn nicht klar ist, was erlaubt ist und was nicht, sollte es nicht heißen, dass alles erlaubt ist, sondern bei Unklarheiten über die Legalität einer Aktion sollte diese unterlassen werden. Das zweite Argument beruht wieder nur auf persönlichen Erfahrungen, ist also induktiv: Der Anteil an befragten Jugenlichen ist nicht repräsentativ für die Allgemeinheit und kann somit auch nicht auf diese übertragen werden.
Des Weiteren argumentiert der Autor, dass das Vorurteil, dass Computerspiele Zeitverschwendung sind und negative Auswirkung auf Psyche und Verhalten von Kindern haben, zu pauschal sei. Digitale Spiele hätten Lerneffekte und 'sozialen Charakter'. Was für Lerneffekte das sind und worin dieser 'soziale Charakter' besteht wird allerdings nicht näher erläutert. Untersuchungen bestätigen daneben, dass nicht jeder Killerspiel-Gamer automatisch zu agressivem Verhalten neige.
Der letzte Mythos, der vom Autor aus dem Weg zu räumen gilt, ist, dass die 'digital natives' durch das Internet verdummen. Hier argumentiert Gassler mit einer Reihe an Studien. Zum einen sei belegt, dass die Intelligenz von Generation zu Generation ansteigt, zum anderen sei ein Zusammenhang zwischen Internetnutzung und Lernerfahrungen der Jugendlichen wissenschaftlich bestätigt. Die Generation verfüge durch die Fähigkeit, neue Technologien zu nutzen, über ein großes Potential, was sich beispielsweise in ihrer Rolle in Barack Obamas Wahlkampf gezeigt habe.
Abschließend legt der Autor die Intention des von ihm verfassten Textes dar, die im Wesentlichen darin bestehe, durch das Aufräumen mit Vorurteilen und Halbwahrheiten eine differenzierte Diskussion über neue Medien zu erleichtern und anstelle der oft propagierten Nachteile und Risiken dieser die Vorteile und Chancen aufzuzeigen. Gleichzeitig betont er aber auch, dass die digitalen Medien zweifellos auch Gefahren birgen.
PS: Ich bin 12. Klasse, Gymnasium, und habe Deutsch als Ergänzungsfach.