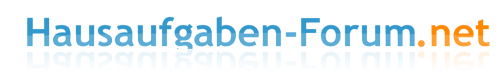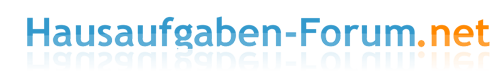Hallo. Ich brauche Hilfe bei meiner Sachtextanalyse. Ist schon eine Weile her als ich die letzte schrieb, daher würde ich mich sehr über Verbesserungsvorschläge freuen. Die Analyse ist für den Kommentar "Die Sprache ist eine Waffe" von Wolf Schneider (Link: http://www.zeit.de/2012/20/Sprache ... bis "[...] hineinzuwachsen!"). Hier meine Sprachanalyse (ohne Inhaltsangabe):
Herr Schneider möchte mit seinem Kommentar an Zielgruppen mit gehobenem Bildungsstand appellieren. Besonders Personen, die sich, wie er selbst, für die Entwicklungen der Sprache interessieren, sind angesprochen. Der Autor erwähnt die Sprachentwicklung in deutschen Schulen und die Lesefaulheit junger Leute. So appelliert er auch an Jugendliche, Eltern und Lehrer, die er zum Nachdenken anregen möchte. Dies zeigt er im letzten Sinnabschnitt sehr deutlich – zum Beispiel ist er prinzipiell nicht gegen das „Kiezdeutsch“, wertet allerdings die Reaktion von gelehrten Sprachwissenschaftlern ab, die die diesen Slang loben und den Jugendlichen damit die Möglichkeit praktisch vorwegnehmen, sich ein angesehenes Hochdeutsch anzueignen. Einige Fachbegriffe aus dem Internet verweisen auf die vom Autor vorausgesetzten Kenntnisse des Lesers. (Z. 46: Fachbegriffe: „Mail, Blog, Tweet, Chat“)
Der Kommentar „Die Sprache ist eine Waffe“ ist ein Appell an den Leser. Herr Schneider stellt Hinweise auf die „Verarmung und Verschandlungen“ (Z. 44 Alliteration) unserer Sprache deutlich heraus. Er möchte den Leser auffordern, den Umgang mit der Sprache mehr wertzuschätzen und an diesem „gewaltigen Erbe“ (Z. 3) festzuhalten. Herr Schneider demonstriert seine Meinung über die heutigen Entwicklungen unserer Sprache klar. Als Verfechter der von ihm so genannten „lebendigen“ Sprache, womit er meint, dass sie beeinflussbar, herzerwärmend oder sogar manipulativ sein kann und dem Wandel der Zeit unterworfen ist, kann er die derzeitig umstrittenen Entwicklungen der Sprache nicht gut heißen. Seiner Meinung nach entwickelt sich das Deutsche eher ins Negative, als gefördert und ausgebaut zu werden – er behauptet, sie verfällt sogar. Herr Schneider überlässt dem Leser, ob er diesen Appell persönlich nimmt und sich Gedanken über seine eigene Sprachentwicklung macht oder nicht.
Die gehobene Umgangssprache, in die der Kommentar verfasst ist, ist typisch für „Die Zeit“ und spricht somit die Zielgruppe an. Der Text enthält zahlreiche Informationen und ist sprachlich teils komplex, teils einfach gestaltet. So findet man hypotaktische Sätze, die über mehrere Zeilen fortlaufen (Z. 29-31), zur Schilderung von Gedanken und zur Darstellung komplexer Zusammenhänge. Aber auch parataktische Sätze und Ellipsen (Z. 7: Ein-Wort-Ellipse und Appell „Gerechtigkeit!“; Z. 43 „Entwickeln wir mit! Halten wir die Sprache lebendig!“) sind zu erkennen.
Bereits im ersten Satz stellt er mit der Alliteration (Z. 1: „Wie wir hören, wie wir lesen, wie wir sprechen, wie wir schreiben […]“) und zahlreichen Akkumulationen (Z. 5: „Träumen, Visionen, Ideen“) die Wichtigkeit der Sprache heraus. Seine Begeisterung für die Sprache demonstriert er sehr deutlich, indem er sie als „schillerndes, grandioses Erbe“ (Z. 17) bezeichnet. Daher benutzt er rhetorische Fragen in Bezug auf die Wortverfälschungen mancher Schreiber („Hören solche Schreiber sich selber nicht mehr zu?“). Zur Darlegung seiner Meinung über die sozialen Netzwerke nutzt er ein Parallelismus (Z. 46: […] die Zahl der geschriebenen Wörter drastisch vermehrt und die Sorgfalt im Umgang mit ihnen drastisch verringert.“).
SamanthaB